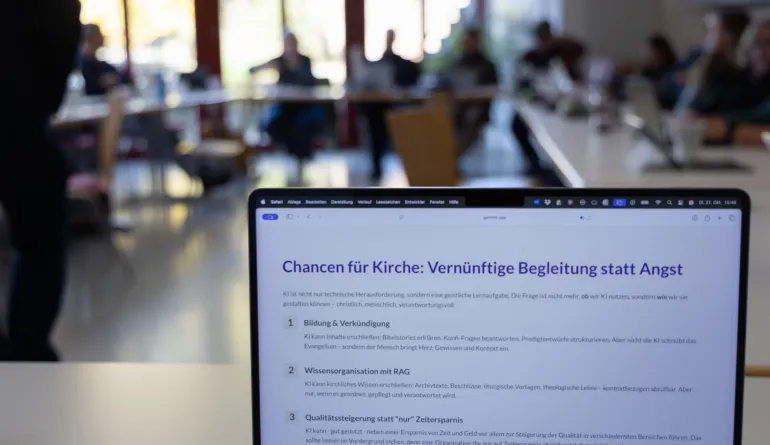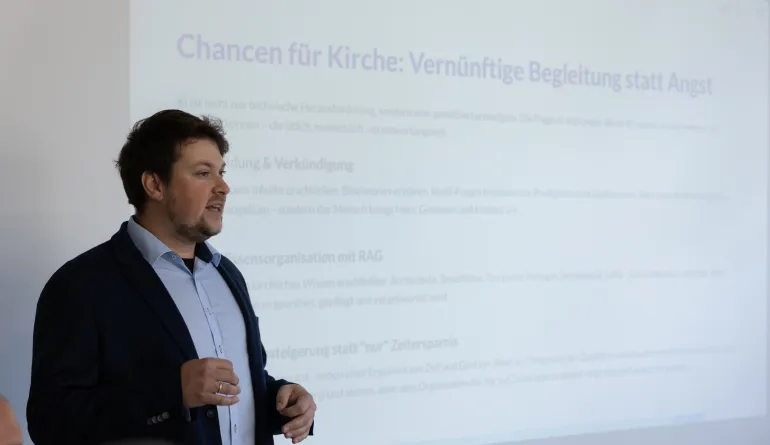Wie KI unseren Arbeitsalltag verändert

Ansprechperson

Sebastian Heilmann
„Schreib mir eine Predigt über die Jahreslosung.“
„Erstell ein Konzept für den nächsten Jugendgottesdienst.“
„Fass die letzte Besprechung zusammen.“
Was vor zwei Jahren noch Science-Fiction war, ist heute Realität: KI-Assistenten können in Sekunden Texte erstellen, die vor wenigen Jahren Stunden Arbeit gekostet hätten. Doch was bedeutet das für unsere Arbeit? Beim ersten Studientag der Wirkstatt evangelisch am 21. Oktober im Tagungszentrum Delta im KJR Nürnberg-Stadt gingen rund 30 Mitarbeitende genau dieser Frage nach.
„Wir müssen die Werteladung sichtbar machen"
Den Auftakt gestaltete Oberkirchenrat Max Niessner, Digitalisierungsexperte der EKD, mit einem Impulsvortrag zu Grundlagen und ethischen Aspekten von KI. An mehreren Beispielen machte er deutlich, worum es geht: „Wenn ein KI-System für die Personalauswahl trainiert wird und die historischen Daten zeigen, dass vor allem Männer bevorzugt wurden, lernt die KI genau das – und reproduziert die Diskriminierung." Seine Botschaft: KI ist nie neutral. Sie übernimmt Werte und Vorurteile aus den Daten, mit denen sie gefüttert wird. Niessner spannte den Bogen von ethischen Grundfragen bis zu theologischen Perspektiven: Was bedeutet es, wenn Algorithmen mitentscheiden? Welche Verantwortung trägt die Kirche im digitalen Wandel? Und wo liegen die Chancen? „KI kann uns helfen, theologisches Wissen besser zu organisieren, Predigten vorzubereiten oder Konfi-Fragen zu beantworten", erklärte er. „Aber wir müssen die Werteladung von Algorithmen bewusst wahrnehmen und kritisch begleiten."
Ordnung im Datenchaos
Besonders praxisnah wurde es bei den RAG-Systemen (Retrieval-Augmented Generation). Diese Technologie könnte eine Antwort auf ein altbekanntes Problem sein: statt eines gut gepflegten Data-Warehouse herrscht das kirchliche Datenchaos. Synodenprotokolle hier, Archivmaterial dort, theologische Gutachten irgendwo in einer Ablage – wer kennt das nicht? Das stellt für Menschen ein Problem dar, weil wichtige Dokumente nicht oder nur langsam gefunden werden. RAG-Systeme durchsuchen solche Datenbestände intelligent und liefern kontextbezogene Antworten. Das funktioniere aber nur wenn mit einer guten Datenhaltung. „Nur wenn wir eine gute Datenhaltung hinbekommen, werden wir es schaffen mit KI große Effizienz- und Qualitätsgewinne als Kirche zu erzielen. Statt stundenlang in Ordnern zu wühlen, könnte ich künftig einfach fragen: Was hat unsere Landeskirche zum Thema Klimaschutz beschlossen?", beschrieb Niessner die Vision. Im Raum war spürbar: Hier öffnet sich ein Fenster zur Zukunft kirchlicher Wissensarbeit.
Wenn der Chatbot plötzlich mitdenkt
Am Nachmittag wurde es konkret. Im Co-Working Space probierten die Teilnehmenden verschiedene KI-Tools aus – von ChatGPT über Bildgeneratoren bis zu Übersetzungsprogrammen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig:
- Gemeindebrief-Artikel umformulieren und in verschiedene Zielgruppensprachen übersetzen
- Bilder für Instagram-Posts oder Plakate von Konfi-Freizeiten generieren
- Protokolle von Sitzungen und Besprechungen automatisch transkribieren
- FAQ-Bots für Gemeindehomepages entwickeln, die häufige Fragen beantworten
- Andachten und Impulse als Ideengrundlage entwerfen
- Komplexe theologische Texte für unterschiedliche Altersgruppen aufbereiten
- Veranstaltungskonzepte und Ablaufpläne strukturieren
- Übersetzungen von fremdsprachigen Texten für interkulturelle Gemeindearbeit
- Liedtexte und liturgische Formulierungen modernisieren
„Ich war überrascht, wie präzise die Vorschläge waren – aber ich habe auch gemerkt: Die KI versteht den Kontext nicht wirklich. Sie kann formulieren, aber nicht mitdenken", resümierte eine Teilnehmerin. Ein anderer ergänzte: „Gutes Prompten ist wie gutes Briefing – je klarer ich formuliere, desto besser das Ergebnis." Diese Erkenntnis teilten viele: Prompten ist eine Schlüsselkompetenz geworden.
Effizienz ja – aber zu welchem Preis?
Der Studientag machte deutlich: KI bietet enorme Potenziale für Effizienzgewinne und kann Routineaufgaben erheblich erleichtern. Doch die Diskussionen zeigten auch kritische Fragen auf, die nicht ignoriert werden dürfen. Wo verläuft die Grenze zwischen Unterstützung und Abhängigkeit? Wenn KI-Systeme zunehmend Texte formulieren und Entscheidungsgrundlagen liefern, droht die Gefahr, dass menschliche Urteilskraft und persönliche Handschrift verloren gehen. Besonders in der kirchlichen Arbeit, die von authentischen Begegnungen und individueller Zuwendung lebt, muss kritisch reflektiert werden: Was darf automatisiert werden – und was nicht?
Hinzu kommt die Frage nach Transparenz und Kontrolle: Wie entstehen KI-generierte Inhalte? Welche Daten fließen ein? Welche Werte und Vorurteile sind in den Algorithmen eingeschrieben? Die algorithmische Voreingenommenheit, die Oberkirchenrat Niessner thematisierte, bleibt eine Herausforderung, die kritische Wachsamkeit erfordert.
Auch ökologische und soziale Aspekte dürfen nicht ausgeblendet werden: Der Energieverbrauch großer KI-Modelle ist erheblich, die Arbeitsbedingungen in der Datenlabeling-Industrie oft prekär. Wer KI nutzt, trägt Mitverantwortung für diese Systemzusammenhänge.
Die Wirkstatt evangelisch will das Thema deshalb weiter begleiten – mit Neugier, aber auch mit einem klaren Bewusstsein für die ethische Verantwortung. Die Landeskonferenz, das Treffen der Hauptberuflichen in der Evangelischen Jugend in Bayern, tagt im Februar 2026 zum Schwerpunktthema „Blessed by AI – Evangelische Jugendarbeit und KI“.
Zum Weiterlesen und Ausprobieren
- KI-Strategie der ELKB – Wie die Landeskirche KI einsetzen will
- KI-Campus – Kostenlose Lernplattform für Künstliche Intelligenz
- EKD-Impulspapier „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz" – Theologische und ethische Perspektiven
- Angebote von jugendarbeit.de – Selbstlernkurs KI und Jugendarbeit und Kirchlicher KI-Führerschein